
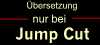
.
Der letzte Film des Regisseurs und Drehbuchautors Paul Thomas Anderson,
Boogie Nights, war im Grunde - trotz der alle Aufmerksamkeit auf sich ziehenden
Beschäftigung mit der Pornoindustrie, im Grunde eine Geschichte zum
Thema Familie.
Dirk Diggler und Rollergirl litten unter Eltern, die bösartig
oder abwesend waren; Amber Waves verlor ihre Kinder an ihren herzlosen
Ex-Mann. Sie gerieten in eine Gruppe, die auf andere Weise eine
Atmosphäre von Geborgenheit, Hilfe, und eben - das war
das wichtigste dabei - Familie schuf. Zufälligerweise handelte
es sich auch um eine Gemeinschaft, deren Mitglieder eine Menge
bewusstseinsverändernde Substanzen zu sich nahm und vor laufenden
Kameras Sex miteinander hatten.
In Andersons neuem Film Magnolia geht es noch
sehr viel deutlicher um Eltern und Kinder, nur diesmal
ohne Phallus-Prothesen und bezahlten Sex; seltsamerweise sind die Familien
diesmal aber eher noch dysfunktionaler.
Magnolia kreist um eine Gruppe einsamer, mit ihrem
Leben unzufriedener Kalifornier - der Titel bezieht sich auf
eine Straße im Valley - und bewegt sich von einer
Nebengeschichte zur nächsten, manchmal ganz unverbunden, manchmal
mit sehr dünnen Fäden verknüpft. Zwei der
Geschichten sind besonders bewegend. Ein schüchterner
und prüder Cop (John C. Reilly) und seine Beziehung zu einer
netten, aber neurotischen Drogensüchtigen (Melora Walters); eine
fremd gehende Ehefrau (Julianne Moore), die mit überraschend wieder
auftauchenden Gefühlen für ihren todkranken Gatten (Jason Robards)
zu tun hat, während dessen Pfleger (philip Seymour Hoffman)
nach dessen entfremdeten Son sucht, der ein aggressiver und sexsüchtiger
Selbsthilfe-Guru ist (Tom Cruise).
Die Leistung von Tom Cruise hat viele
eine Oscar-Nominierung fordern lassen, vor allem, weil
er ein Filmstar ist, der es zulässt, mit
einer grässlichen Frisur und wie ein Vollidiot auf
der Leinwand zu erscheinen. Er ist auch wirklich gut,
aber das sind seine Co-Stars auch; alle hätten eine
Nominierung verdient. Besonders bemerkenswert ist Julianne
Moores Leistung. Sie spielt präzise auch noch in Momenten
höchster emotionaler Intensität.
Trotz der dynamischen Bilder, der Bedeutung der Musik ist Magnolia
zu allererst ein Schauspielerfilm. Selbst in den weniger überzeugeden
Geschichten, sind die Darsteller herausragend, von William H. Macy
als erledigtem einstigen Kinderstar bis zu Philip Baker Hall als
alterndem Quizshow-Gastgeber im Kampf
gegen seinen körperlichen und moralischen Niedergang.
Sogar die kleineren, weniger auffälligen Rollen werden von
herausragenden Darstellern wie Felicity Huffman und April Grace
verkörpert.
Kein Wunder, dass sie alle in einem Paul-Thomas-Anderson-Film mitspielen
wollen. Die Gründe liegen auf der Hand: gewichtige Monologe, Charaktere
mit interessanten Hintergründen, Gelegenheiten zur Improvisation.
Dazu noch Zigaretten umsonst und die Plattform, von
der sich verkünden lässt, dass Ruhm weniger wichtiger ist
als gutes Handwerk, das ist dann der Traum jedes Schauspielers. Mit seinem
riesigen Ensemble lose verknüpfter, sehr schauspielerhafter Charaktere
ist die Struktur von Magnolia mehr als einfach nur Altmanesk, wie
so viele Kritiker behauptet haben - es ist der Film, auf den
das Etikett Altmanesk seit Jahren gewartet hat.
Aber Anderson hat seinen eigenen Stil und Magnolia trägt dieselbe
Handschrift wie schon Boogie Nights: kinetische Kamera, ein
hervorragend passender und oft geschmackloser Rock'n'Roll-Soundtrack
- und die Länge. Opernhafte, selbstverliebte, fast
provozierende Länge. In diesem Sinne hat Anderson mehr
mit Dirk Diggler gemeinsam als das jungenhafte
Lächeln.
Das Mainstream-Publikum hat möglicherweise keine Lust, sich einem
dreistündigen Film auszuliefern, in dem Tom Hanks nicht
mitspielt, und ganz gewiss gibt es mehrere Stellen, die man hätte
kürzen und straffen können, ohne dem Film zu schaden.
Manche der Geschichten sind fast zum Überdruss vertraut und
laufen auf enttäuschende Banalitäten hinaus - tu immer das
richtige; sei nett zu Kindern. Damit bleibt Anderson unter
seinen Möglichkeiten als Filmemacher.
Einige der Parallelismen des Plots - sterbende Männer,
gestandene Untreue - sollen sich gegenseitig erläutern,
stattdessen erzeugen sie das Gefühl unnötiger Wiederholung.
Einige der längeren Monologe, deutlich länger als
Meat-Loaf-Songs, müssten dringend gekürzt werden. Andersons
Experiment, seine Figuren voneinander getrennt denselben
Aimee-Mann-Song mitsingen zu lassen, ist zwar eine originelle
und schräge Idee, funktioniert aber nicht, bleibt bloß
schrilles Karaoke.
Und während es immer nett ist, einen Film zu sehen, der einem
keine wohlverpackte Botschaft zukommen lässt, hat man nach dem
Abspann ein wenig das Gefühl, dass Magnolia nicht sehr viel mehr
ist als die Summe seiner Teile, weder so einheitlich noch erinnernswert
wie Boogie Nights.
Aber Andersons Schwächen verdanken sich - wie bei Boogie
Nights - denselben Impulsen wie seine Stärken und es schiene
im besten Falle gefährlich, im schlimmsten aber kontraproduktiv,
zu verlangen, er solle sich selbst beschränken.
Und wenn die unerwartete Auflösung beginnt, ist ohnehin alles
verziehen.
|